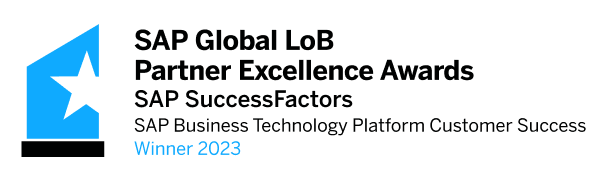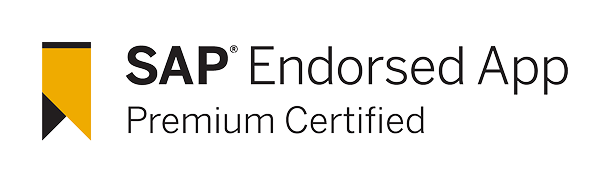In einer zunehmend dynamischen und global vernetzten Wirtschaft stoßen klassische, streng hierarchische Organisationsmodelle wie die funktionale Organisation, das Mehrliniensystem oder die traditionelle Aufbauorganisation schnell an ihre Grenzen. Märkte verändern sich heute in einem Tempo, das vor wenigen Jahrzehnten noch unvorstellbar war. Neue Technologien, globale Wettbewerber, der Fachkräftemangel und veränderte Kundenerwartungen setzen Unternehmen unter enormen Anpassungsdruck. Wer in diesem Umfeld wettbewerbsfähig bleiben will, benötigt Strukturen, die Flexibilität, schnelle Entscheidungsfindung und Kooperation über Abteilungs- und Ländergrenzen hinweg ermöglichen.
Genau hier setzt die Netzwerkorganisation an. Sie ist eine Organisationsform, die Effizienz mit Agilität und Innovationskraft verbindet und damit eine zeitgemäße Weiterentwicklung der klassischen Aufbauorganisation darstellt. Ob als Unternehmensnetzwerk, virtuelle Organisation oder interne Projektplattform: eigenständige Einheiten werden zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem verbunden, das ein gemeinsames Ziel verfolgt und sich laufend an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann.